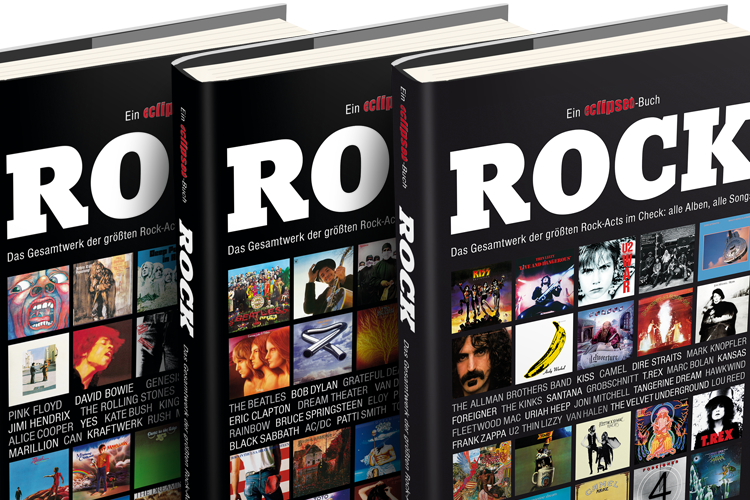Etwas Stammesgetrommel, ein paar Zupfinstrumente, dazu diese klare Frauenstimme, traditioneller Gesang, irgendwo im nordafrikanischen Raum zu verorten, vielleicht auch einige arabische Harmonien. Und dann, nach 52 Sekunden, kommt der E-Bass hinmzu, spielt einen treibenden urbanen Dance-Groove. Welch ein Gegensatz! Aber im selben Augenblick: welch eine Symbiose! „Salam Nubia“, der Opener von „Manara“, dem zweiten Album von Alsarah And The Nubatones, ist ein Paradebeispiel für die Musik des New Yorker Quintetts. „Salam Nubia“, das mag man mit „Frieden für Nubien“ oder auch „Gegrüßt sei Nubien“ übersetzen. Diese Formel kommt nicht von ungefähr, stammt doch die Komponistin, Texterin und Sängerin Alsarah aus dem Sudan, der teilweise zum historischen Nubien, dem Reich von Kusch, gehörte.
1982 als Sarah Mohamed Abunama-Elgadi in Sudans Hauptstadt Khartum geboren, wurde Alsarah 2013 von der britischen Zeitung „The Guardian“ als neue Prinzessin des nubischen Pop bezeichnet. Ein Titel, der der so Geehrten nicht behagt: „Ich schätze zwar den gewissen Sinn fürs Dramatische in dieser Bezeichnung, denn er passt zu meinen Auftritten. Aber ehrlich gesagt, sehe ich mich nicht so.“ Spannender vielleicht ist der Umstand, dass der „Guardian“ dies vor drei Jahren sagte – ein Jahr, bevor Alsarah And The Nubatones ihr Debütalbum „Silt“ veröffentlichten. Bis dahin war es ein weiter, beschwerlicher Weg für die Künstlerin.
Von der Diktatur in den Krieg
„Meine Eltern waren Menschenrechtsaktivisten, und da im Sudan ein Diktator den anderen ablöste, hatten sie ständig Ärger mit den Behörden“, umreißt sie den Ausgangspunkt ihrer Reise in die Welt. Sie erinnert sich an das Jahr 1989, als der jetzige Präsident Umar al-Baschir sich mithilfe des Militärs an die Macht putschte: „Viele Leute, die sich für Freiheit und Demokratie stark gemacht hatten, verschwanden und tauchten in Leichensäcken wieder auf.“ Alsarahs Familie floh in den Jemen, nach Taizz, die 450.000-Einwohner-Metropole im Südwesten des Landes. Doch auch dort war sie nicht lange sicher, 1994 brach ein Bürgerkrieg aus. Alsarahs Mutter arbeitete für eine US-amerikanische NGO, die ihre erneute Flucht organisierte. „Wir wurden in einem Militärflugzeug evakuiert und nach Saudi-Arabien geflogen. Dort sagte man uns: ‚Hier könnt ihr nicht bleiben‘. Schließlich sind wir dann eher zufällig in den USA gelandet.“
Die Vereinigten Staaten sind nun seit mehr als zwanzig Jahren ihre Heimat. Eine Heimat, in der sie sich assimiliert hat. Eine selbstbewusste junge Frau, die mit ihren extrovertiert toupierten Haaren sofort auffällt. Genauso wie mit ihrer Kleidung. Bunte Textilien, die zwar nicht afrikanisch sind, aber doch von Ferne an die farbenfrohen Trachten ihrer Heimat erinnern. Alsarah ist sich ihrer Herkunft sehr wohl bewusst, mehr noch: Ihre Herkunft ist essenzieller Bestandteil ihrer Musik. „Manchmal verlässt man seine Heimat freiwillig, manchmal muss man fliehen. Manchmal plant man, wieder zurückzukehren. Manchmal weiß man nicht, ob man all seine Freunde und die geliebten Menschen wiedersieht. Aber eines weiß ich: Ich möchte sie nicht vergessen und nicht [von ihnen] vergessen werden.“

Reise durch Afrika
„Salam Nubia“ ist Programm und zugleich musikalisches Abbild des gesamten Albums. Klare, eingängige Gesangsmelodien, schnelle Rhythmen, stimmungsvoll, ein kurzer Instrumentalteil. Alle 14 Songs sind in dieser oder einer ähnlichen Art gestaltet. Eine Ausnahme bilden die drei kurzen Zwischenspiele; sie machen aus „Manara“ einen Fluss. Das Album ist konzipiert, als Ganzes gehört zu werden. Es hat zwar keinen Hörspielcharakter, doch verschiedene kleine Geräuschkulissen lassen an einen Gang über afrikanische Märkte, an Wanderungen durch Dörfer und Städte denken. „Alforag“ mit seinen klappernden Percussions und dem Akkordeon ist einschmeichelnd, „Albahr“ klingt wie Wilder Westen auf Afrikanisch, „3yan T3ban“ mit seinem tiefen Bassgroove ist hypnotisch, ein schräger Instrumentalteil verpasst „Ya Watan“ das i-Tüpfelchen, während „Nar“ erst ruhig beginnt, dann forsch drauflos rockt, nur um am Ende drone-artig auszuklingen.
Als „East-Africa Retro Pop“ bezeichnet Alsarah selbst ihre Musik. Der Begriff „Retro“ will angesichts ihrer modernen Frische jedoch nicht recht passen. „Zeitgenössische Musik muss doch nicht notwendig Techno sein oder auf elektronischen Instrumenten eingespielt werden“, so Alsarah. „Manche Leute denken, traditionelle Musik sei etwas Althergebrachtes. Das muss nicht sein. Ich versuche, sie einer Frischzellenkur zu unterziehen.“ Insofern hat sie recht. Ihre Musik, auch die des Debüts „Silt“, verweist auf den Afro-Soul der Sechziger- und Siebzigerjahre, der sein Vorbild im Abendland suchte. Der Zusammenklang mit den afrikanischen Instrumenten ergibt diese fiebrige, exotische Melange.
Zwiti
Boston war Alsarahs erste Station in den USA. Dort absolvierte sie ein Studium mit Schwerpunkt Vergleichende Musikwissenschaft an der Wesleyan University. „Die Anfangszeit war für die gesamte Familie hart. Wir mussten uns erst von den Traumata befreien. Aber es machte mich auch stark. Ich habe erkannt, welches Glück ich hatte, all den Dingen im Sudan und Jemen zu entkommen. Andere hatten weniger Glück.“ Nach ihrem Abschluss zog sie 2004 nach New York, wo sie noch heute lebt.
Musik war schon immer ihr Begleiter, beginnend mit Bootlegkassetten im Jemen. „Musik war mein Zuhause, meine Art mich auszudrücken, mein Weg die Welt kennenzulernen. Sie zeigte mir, dass jeder eine Kultur hat, die ihn ausmacht. Das ist auch der Grund, warum ich immer auf afrikanische Klänge zurückkomme.“
Alsarahs Band The Nubatones besteht nicht nur aus sudanesischen Musikern. Perkussionist Rami El-Aasser ist Amerikaner mit ägyptischen Wurzeln, Bassist Mawuena Kodjovi stammt aus Togo, Haig Manoukian, der auf „Silt“ an der Oud zu hören ist und kurz nach der Veröffentlichung verstarb, aus Armenien.
Mit El-Aasser begann Alsarahs musikalische Laufbahn. Gemeinsam spielten sie sansibarische Liebeslieder der 1940er- bis 1970er-Jahre, diskutierten über afrikanische Musik, kulturellen Austausch und gemeinsame Migrationserfahrungen. Die Idee zu Alsarah And The Nubatones wurde in dieser Phase geboren. 2013 kam es zum Kooperationsalbum „Aljwal“ mit dem französischen Produzenten Débruit und zur Beteiligung am Debüt des Nile Project; schließlich folgte 2014 der eigene Platteneinstand. Auf YouTube finden sich offizielle Videos von „Silt“. Einfache, ästhetische Bilder einer sudanesischen Frau, die im Big Apple angekommen ist.
Ihre Stimme, die afrikanischen Melodien und die vielen Percussions sind die Markenzeichen des neuen Albums „Manara“. Doch der New Yorker Musiker Brandon Terzic setzt auf den afrikanischen Zupfinstrumenten Oud und Ngoni gleichsam Highlights. Gerade mit der Oud prägt er den Sound, legt flirrende Soli in die kurzen Instrumentalpassagen. Im melancholischen Titelsong weiß er an der Ngoni zu überzeugen, in „Eroos Elneel“ ist es wieder die Oud und der kanonartige, mehrstimmige Gesang, während „Asilah“ lässig und romantisch zugleich erscheint. „Manara“ ist ein vielschichtiges Album. Es bietet nicht nur afrikanisches Flair, nicht nur Grooves zum Mitwippen und Melodien zum Mitsingen. Es birgt auch viele kleine Perlen, nach denen man mit wachen Sinnen tauchen muss.
„Ich fühle mich in erster Linie als Immigrantin. Die Band ist ein Schmelztiegel von Immigranten. Wir kommen alle aus unterschiedlichen Regionen, und das macht einen Großteil von uns aus“, fasst die Sängerin zusammen. „Afrikanische Musik hat in den letzten Jahren ein Revival erfahren. Überhaupt denke ich, dass Afrika die Zukunft gehört und dass es dort zu einer Renaissance in der Kunst und Musik kommen kann.“ In diesem Sinne verbreitet Alsarah ihre Mischung aus mindestens zwei Kulturen. Sie wird bei ihren Auftritten bestaunt und gefeiert, sei es in Dubai oder in Kenia. Für das Frühjahr plant sie eine Tournee durch Europa.
*** Bernd Sievers