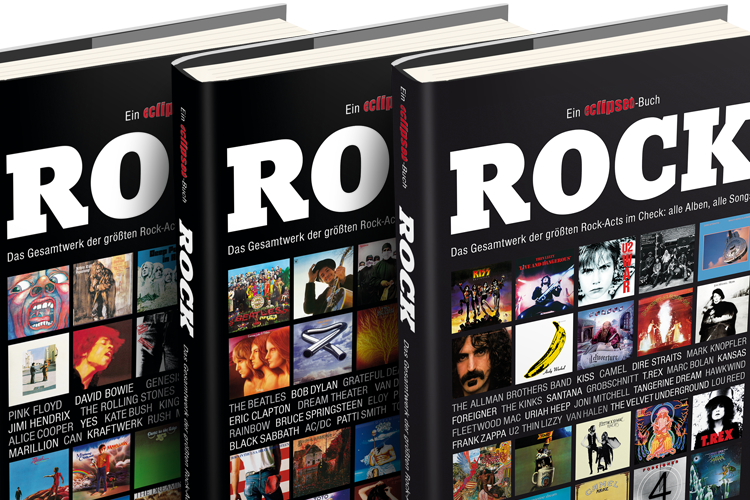Am späten Nachmittag des 24. August wurde bekannt, dass Charlie Watts, seit 1963 Schlagzeuger der Rolling Stones, im Alter von 80 Jahren in einem Londoner Krankenhaus gestorben war. Für einen Moment stand die Musikwelt still, und nicht nur Stones-Fans wussten, dass mit dem stillen Drummer einer der ganz Großen gegangen war. Die ungewöhnlich vielen und warmherzigen Trauerbekundungen von Kollegen und Kolleginnen aus allen Musikgenres bestätigten das. Abschied von einem Gentleman, der zur weltweit verehrten Legende wurde.
Er hat nie aufgehört darüber zu staunen, wie weit er es im Zeichen der Zunge gebracht hatte. Und immer auch schien er ein wenig zu fremdeln mit der glamourösen Welt des Pop, mit ihrer Etikette, ihren Kindereien und Aufgeregtheiten. Auf Bandfotos grinste er, wenn überhaupt, eher linkisch, und nicht selten wirkte er, als wäre es ihm ein wenig peinlich, schon wieder mit diesen Leuten abgelichtet zu werden. Umso erstaunlicher, dass die Welt diesen Charlie Watts nun, da er am 24. August, wenige Wochen nach seinem 80. Geburtstag, unerwartet verstorben ist, mit Superlativen überhäuft: einzigartig, unersetzlich, King of Cool, Legende. Geboren wird Charles Robert Watts am 2. Juni 1941 in eine Welt, die wir höchstens noch durch ZDFinfo kennen: Hitlers „Blitz“ hält London in Angst und Schrecken, Churchill verspricht „Blut, Schweiß und Tränen“, und die Royal Air Force atmet nach der gerade erst gewonnenen Luftschlacht um England vorsichtig auf. Charlies Vater verdient sein Geld als Lastwagenfahrer, die Mutter, eine ehemalige Fabrikarbeiterin, versorgt den Haushalt. Mit 13 Jahren entdeckt der Filius das Schlagzeug für sich. Die musikalischen Fixsterne für den Teenager sind Jazz- und Tanzorchester wie die von Earl Bostic, Billy Eckstine und Duke Ellington.
Swing statt Spektakel
Zeitlebens wird Watts der Musikwelt seiner frühen Jahre treu bleiben, sein Spiel wird geprägt von Jazzgrößen wie Max Roach, Chico Hamilton und Elvin Jones. Er beherzigt die Tugenden, die einen guten Jazzdrummer ausmachen. Swing statt Spektakel, ein Gefühl für den Song und die Beschränkung auf das Notwendige. Watts lernt: Wo ein Schlag sitzt, wäre jeder weitere zu viel. Hören kann man das Jahre später beispielhaft in den großen Stones-Hits, etwa im entspannten und doch so straffen Groove von „Honky Tonk Women“, im federnden Swing von „Brown Sugar“ oder dem elastischen Flow von „Tumbling Dice“. Mögen andere wie Keith Moon, John Bonham oder Neil Peart spektakulärer, kraftvoller oder virtuoser trommeln, Watts beschränkt sich auf ein minimalistisches Set und liefert den Stones passgenaue Grooves, die ihren Songs erst Eloquenz und Durchschlagskraft verleihen. Auch wenn er für das breite Publikum womöglich „nur“ der Drummer war, unter Kollegen genießt der stoische Stone seit je den exzellenten Ruf eines „Musician’s Musician“. Die auffällig vielen und warmherzigen Lobeshymnen von Drummern aller Genres, die sich nach dem Tod des Trommlers zu Wort melden, bestätigen das. Watts’ langjähriger Drumtech Don McAuley brachte es auf den Punkt: „Charlie spielte nicht die Drums, er spielte den Song.“