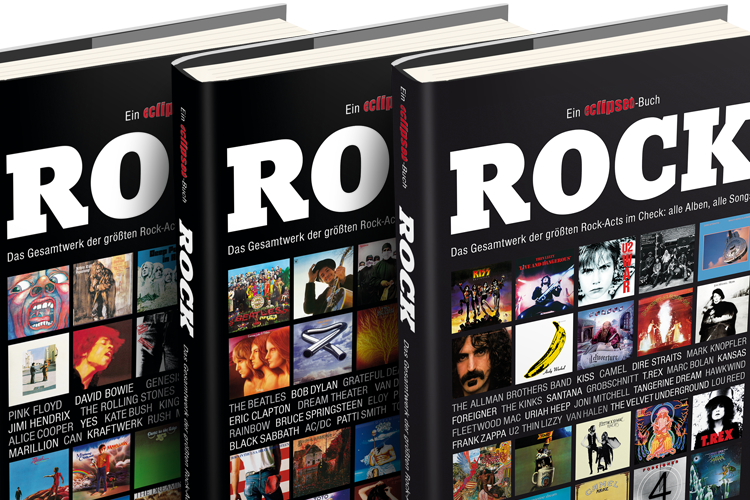Jahrzehntelang war er eine Art Vorzeigesongschreiber des Westcoast-Rock: ein Beau mit Ohrwurmsongs, berühmten Musikerfreunden, adretten Gespielinnen und hippieskem Lifestyle und ein vorbildlicher Polit- und Umweltaktivist. Doch mit inzwischen 72 Jahren muss auch Jackson Browne ein paar Gänge zurückschalten. Das manifestiert sich in immer selteneren Alben, Tourneen und Interviews. Mit „Downhill From Everywhere“ veröffentlicht er sein erstes Lebenszeichen seit sieben Jahren – ein ambitioniertes Spätwerk, das vielseitig und zugleich sanft daherkommt.
Manchmal fällt es einem schwer, einfach offen und direkt nach dem zu fragen, was man von seinem Gegenüber wissen will. Schließlich möchte man niemandem zu nahe treten oder ihn gar verletzen. Wie bei einem der raren Interviews von Jackson Browne Ende April: Da sitzt er in seinem Privatstudio im kalifornischen Santa Monica, gibt den ergrauten Märchenprinzen und tut, als liefe seine Karriere noch genauso gut wie in den 70ern und 80ern und als hätte es den offensichtlichen Popularitätsknick nie gegeben. Die Frage „Was ist passiert?“ will er daher zunächst gar nicht verstehen: „Keine Ahnung, wovon du da redest – beim besten Willen nicht. Willst du etwa sagen, ich sei populär gewesen und sei es jetzt nicht mehr?“
Opfer der eigenen Überzeugungen
Nach dem dezenten Hinweis, dass er 1986 noch europäische Mehrzweckhallen füllte, Co-Headliner der letzten „Rockpalast Nacht“ in der Essener Grugahalle war und mit „Lives In The Balance“ sein letztes wirklich erfolgreiches Studioalbum veröffentlichte, wird er allerdings grüblerischer und selbstkritischer. Zunächst argumentiert er, dass er ohnehin nie das Gefühl gehabt habe, seine Musik sei in nicht-anglophilen Ländern wirklich verstanden und geschätzt worden – eine schallende Ohrfeige nicht nur für alle deutschen Fans. Dann hält er inne: „Vielleicht sollte ich das anders formulieren. O. K., ich höre hin und wieder, meine Musik sei weniger zugänglich und massentauglich, seit ich mich verstärkt auf politische und soziale Themen konzentriere. Dabei war das Mitte der 80er einfach eine Reaktion darauf, dass sich in den USA niemand für Politik interessiert hat. Und wenn du dich dann ausgerechnet mit so einem heiklen Thema wie dem amerikanischen Vorgehen in Südamerika und der Unterstützung von Diktatoren und Putschisten befasst, stößt das nicht selten auf Kopfschütteln. Und ich denke, das ist es, was mir passiert ist: Ich habe unbequeme Themen aufgegriffen, die mir am Herzen lagen - den meisten Menschen aber leider nicht.“